Startups wie Lilium und Volocopter wollen die Zukunft des Fliegens gestalten – wer hat die Nase vorn?

Bis zum Jahr 2050 soll die europäische Luftfahrt klimaneutral werden. Ein ambitioniertes Ziel – schließlich nahmen die Emissionen aus dem Flugverkehr in den Jahren vor der Corona-Pandemie noch stetig zu. Doch die neuesten Entwicklungen in der Branche machen Hoffnung: Große Konzerne wie Airbus und Boeing, aber auch zahlreiche Startups arbeiten an innovativen Antriebstechnologien, Kraftstoffen und Softwarelösungen, mit denen die CO₂-Emissionen reduziert werden können.
Allein in Deutschland sind in den vergangenen Jahren mit Lilium und Volocopter, die elektrische Lufttaxis entwickeln, dem Wasserstoff-Flugzeug H2Fly oder dem E-Fuel-Hersteller Ineratec eine ganze Reihe junger Unternehmen an den Start gegangen, um die Zukunft des Fliegens mitzugestalten. Anders als in der Automobilbranche habe sich in der Luftfahrt noch kein Ansatz durchgesetzt, sagt Lukas Kaestner, Mitgründer des Mentorenprogramms Sustainable Aero Lab.
"Die entscheidende Frage ist: Von welchem Anwendungsfall sprechen wir?" So sei etwa elektrisches Fliegen nur für kurze und regionale Strecken geeignet, weil das Eigengewicht der Batterie die Reichweite begrenze. "Bei klassischem Treibstoff wird das Flugzeug immer leichter, je weiter es fliegt. Diesen Vorteil gibt es bei einem Elektromotor nicht", erklärt Kaestner.
Lilium oder Volocopter: Wer hat das bessere Geschäftsmodell?
In der deutschen Startup-Landschaft konkurrieren verschiedene technologische Ansätze für batteriebetriebenes Fliegen. Volocopter, 2011 in Baden-Württemberg gegründet, hat ein Helikopter-ähnliches Lufttaxi entwickelt, das senkrecht starten und neben dem Piloten einen Passagier befördern kann. Auch Lilium aus Bayern setzt auf einen Senkrechtstarter, der allerdings bis zu sechs Passagiere transportieren soll und einen komplexeren Antrieb mit kippbaren Triebwerken hat.
"Dadurch kann Lilium im Vergleich zu Volocopter effizienter fliegen und eine größere Reichweite erzielen, was ganz neue Geschäftsmodelle eröffnet", erklärt Kaestner, "aber es ist auch das größere Risiko." Es sei derzeit noch nicht absehbar, ob Lilium eine Zulassung für seinen völlig neuartigen Flieger bekomme. "Das ist ein langer, kostenintensiver Prozess mit strengen Regularien. In dieser Hinsicht ist Volocopter am weitesten vorne", sagt Kaestner.
Das Startup aus Baden-Württemberg will sein Flugtaxi bereits zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris als Shuttle einsetzen. Außerdem ist eine Kooperation mit der Luftrettung des ADAC geplant, wo der Volocopter-Flieger klassische Rettungshubschrauber ersetzen könnte. Ähnliche Ansätze verfolgen auch die Startups Joby Aviation und Archer aus den USA. Lilium strebt mit seiner höheren Reichweite dagegen eher regionale Verbindungen zwischen Städten oder Inseln an.

Gibt es einen Markt für Flugtaxis?
Eine dritte Variante in diesem Bereich ist das elektrisch betriebene Flugzeug des Münchener Startups Vaeridion, das am Mentoringprogramm des Sustainable Aero Lab teilnimmt. Anders als Volocopter und Lilium braucht es einen klassischen Flugplatz zum Starten und Landen, kann dafür aber auf bereits bestehende Infrastruktur zurückgreifen und verbraucht weniger Energie für den Start. Zudem ist die Zulassung weniger aufwendig und teuer als bei den Senkrechtstartern.
Neben der Technologie und Infrastruktur stelle sich aber auch die Frage, ob es tatsächlich einen Markt für solche Geschäftsmodell gibt, gibt Kaestner zu Bedenken. Volocopter peilt einen Preis von 10 bis 15 Euro pro Kilometer an – damit würde ein einfacher Flug vom Münchener Stadtzentrum zum Flughafen mindestens 300 Euro kosten. Lilium will durch die höhere Kapazität mit knapp 2 Euro pro Passagier und Kilometer etwas günstiger fliegen; dennoch richtet sich das Angebot wohl in erster Linie an Luxus- und Geschäftskunden.
Hinzu kommt: Start- und Landeplätze für Flugtaxis müssten erst noch gefunden und genehmigt werden. "Dafür gibt es sicher Standorte außerhalb von Deutschland, die sich besser eignen", sagt Kaestner. "Wegen der klimatischen Bedingungen, aber auch wegen der Akzeptanz in der Bevölkerung." Ohnehin sei das elektrische Fliegen durch die begrenzte Reichweite nur eine Ergänzung zum bisherigen Flugverkehr, aber keine geeignete Lösung, um die Emissionen der Luftfahrt insgesamt zu reduzieren.

Wasserstoff oder E-Fuels: Womit fliegen wir in Zukunft?
Als Alternative sieht Experte Kaestner zum einen Wasserstoff-Antriebe. "Das ist ein Thema, was von der deutschen und der französischen Regierung stark vorangetrieben wird." Europäische Branchenriesen wie Airbus oder der französische Triebwerkhersteller Safran seien in diesem Bereich führend. So will Airbus etwa bereits 2035 das Wasserstoff-Flugzeug ZeroE auf den Markt bringen.
Aber auch einige Startups mischen mit: So hat das Stuttgarter Start-up H2Fly bereits 2016 den ersten erfolgreichen Testflug mit seinem Wasserstoffflugzeug HY4 absolviert. Inzwischen sei eine Reichweite von bis zu 1.500 Kilometern möglich – also deutlich mehr als beim elektrischen Fliegern, aber auch deutlich weniger als mit einem klassischen Kerosin-Antrieb. Den Flugbetrieb will H2Fly im Jahr 2029 aufnehmen.
Konkurrenz kommt etwas von Zero Avia aus Großbritannien oder Universal Hydrogen aus den USA. "Es wird spannend zu sehen, inwieweit es neue Player in den Markt schaffen", sagt Kaestner. "Einige Startups wie Universal Hydrogen haben es gut geschafft, sich in Nischen einzufügen." Experimentiert wird derzeit vor allem mit Brennstoffzellen, die aus Wasserstoff Strom produzieren.

Alternative Kraftstoffe sind schon heute verfügbar
Bis die Technologie und die zugehörige Infrastruktur so weit entwickelt sind, dass sie auch für längere Strecken eingesetzt werden können, ist es allerdings noch ein weiter Weg. Schon heute verfügbar und im Einsatz sind dagegen sogenannte Sustainable Aviation Fuels (SAF), also nachhaltige Treibstoffe, die Kerosin beigemischt werden können. "Das wird in den nächsten zwanzig bis dreißig Jahren die einzige Option für Langstreckenflüge sein", prognostiziert Kaestner.
Die alternativen Treibstoffe können etwa aus Altöl oder Biomasse hergestellt oder synthetisch aus Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid gewonnen und mit derselben Infrastruktur wie herkömmliches Kerosin genutzt werden. Der Haken: Aktuell sind die alternativen Treibstoffe bis zu fünfmal so teuer. Um die Nutzung dennoch voranzutreiben, hat die Europäische Union kürzlich Quoten festgelegt, zu denen Betreiber die SAF beimischen müssen.
Diese liegt ab 2025 zunächst bei zwei Prozent und steigt dann schrittweise bis 2050 auf 70 Prozent. "Mit dieser Planungssicherheit können jetzt auch neue Player Gas geben und ihre Ideen verwirklichen", sagt Kaestner. "Es gibt noch viel Potenzial für neue Technologien, die den Prozess schneller und effizienter gestalten können." In Deutschland sind hier etwa Refuel Green aus Dresden oder Ineratec aus Karlsruhe aktiv, die beide bereits Millionenfinanzierungen einsammeln konnten.
Gibt es neben Airbus und Co. noch Platz für Startups?
Insgesamt habe das Thema nachhaltiges Fliegen zuletzt mehr Aufmerksamkeit von Investoren bekommen, stellt Kaestner fest. Auch wenn die Platzhirsche der Branche viel Erfahrung und Kapital vorweisen könnten, sehe er durchaus Raum für Startups im Markt. "Wenn man sieht, welche Herausforderungen die Luftfahrtindustrie vor sich hat, geht das weit über das hinaus, was die großen Konzerne allein abbilden können."
In der Vergangenheit sei bereits in anderen Industrien zu beobachten gewesen, dass die disruptiven Ideen oft von jungen Unternehmen kommen, "die ganz anders denken und handeln", ergänzt der Experte. Besonders viel Potenzial hätten aus seiner Erfahrung oft Startups, die nicht unbedingt die meiste Aufmerksamkeit bekommen, etwa weil sie kleine Stellschrauben wie Sensoren oder Software verbessern. "Aber wenn man das aufsummiert, kann man dadurch einen echten Impact erzielen."
Kaestner hält es für realistisch, dass die europäische Luftfahrt wie geplant bis 2050 klimaneutral wird. "Es wird aber damit einhergehen, dass Fliegen noch einmal deutlich teurer wird." Damit die Kunden das in Kauf nehmen, brauche es auch einen Imagewandel, findet er. "Beim Tesla guckt auch niemand auf den Preis – diesen Spirit brauchen wir in der Luftfahrt. Vielleicht können neue Leuchttürme wie Lufttaxis tatsächlich diese Inspiration geben."

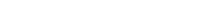 Yahoo Finanzen
Yahoo Finanzen 