E-Autos: Die neue Ladeinfrastruktur kommt zu langsam – und Tesla hat ein Problem

Man kann es drehen und wenden, wie man es will - ein großer Nachteil der E-Autos ist die Zeit, die sie an der Ladesäule verbringen müssen. Sicher, die Top-Modelle der Hersteller kommen mit schnellen Bordladern daher, die theoretisch Ladegeschwindigkeiten von bis 800 kW versprechen. Einen 100 kWh großen E-Auto Akku könnte man also in wenigen Minuten wieder auf 80 Prozent laden. Auch die Akkutechnologie verbessert sich und neue Innovationen sollen die Ladezeiten noch schneller machen.
Die Ladezeiten machen nicht nur den Kunden sorgen, sondern auch den Planern der E-Mobilität. Denn lange Lade- und Standzeiten sind vor allem in Ballungsräumen und in Urlaubszeiten ein Problem. Je länger ein Auto eine Ladesäule blockiert, desto länger dürfte die Schlange an den Autobahnraststätten werden, wenn der Sommerurlaub ansteht. Was die Akzeptanz der E-Mobilität weiter einschränken könnte.
Es geht zu langsam – in doppelter Hinsicht
Nicht ganz zu Unrecht fordert der Lobbyverband der europäischen Autohersteller (ACEA), dass die von der EU schon relativ großzügig auslegten Ausbauzahlen noch weiter erhöht werden. Statt der von der EU geplanten 3,5 Millionen Ladepunkte bis 2030 fordert der Verband 8,8 Millionen. Sonst würde es zu Engpässen kommen, die die Transformation zur E-Mobilität blockieren könnte.
Wenn man aber schaut, welche Art von Ladestationen verbaut werden, dann sieht man, dass vor allem 11 kW, 22 kW und 50 kW Ladestationen auf dem Radar auftauchen. Damit lassen sich die meisten Autos in 30 bis 50 Minuten zumindest auf 80 Prozent aufladen, was einfach zu langsam ist. Und Autos, die theoretisch mit 150 kW und mehr laden können, haben davon überhaupt nichts.
In China, dem Pionierland, wenn es um E-Mobilität geht, hat man das Problem schon länger erkannt. Auch dort wurden bis in jüngster Vergangenheit größtenteils Ladestationen gebaut, die den Akku eher gemächlich aufgefrischt haben. Doch seit dem letzten Jahr ist das anders. Die neuen Ladestationen haben eine Leistung von 1250 Ampere und lassen eine Ladeleistung von bis zu 1000 kW zu.
Auch Tesla verpasst den Anschluss
Dabei sind solche Ladeleistungen bisher reine Zukunftsmusik, denn kaum ein Akku ist in der Lage, dies zu erreichen. Doch das Problem ist, dass die Technologie sich rasend schnell entwickelt. Vor noch zwei Jahren war das Supercharger-Netzwerk von Tesla auch technisch das Maß aller Dinge. Doch mittlerweile hat sich das Bild verändert, was für den US-Autohersteller immer mehr zum Problem wird. Schließlich war es genau dieses Supercharger-Netz, das viele Kunden als großes Plus wahrnahmen. Anbieter wie Ionity, die ein EU-weites Netzwerk an Highspeed-Ladestationen (350 kW) haben, sind heute längst weiter.
Schnelllader sind teuer, was auch der Grund ist, warum Kommunen, die ihre Ladeinfrastruktur selbst aufbauen, auf sie verzichten. Das Problem ist, dass man sich ein Ladenetz aufbaut, das innerhalb weniger Jahre schon wieder veraltet ist. Denn mittlerweile bieten Autohersteller selbst in günstigen E-Autos wie dem neuen Renault 5 Ladegeschwindigkeiten von bis zu 100 kW an. Die neue Generation der E-Autos droht also auf eine schon jetzt veraltete Ladeinfrastruktur zu treffen.
Das gilt insbesondere für die kommende, neue Generation der Akkus. Feststoffbatterien stehen kurz vor dem Durchbruch und werden die momentan vorherrschenden Akkutechnologien ablösen. Sie sollen vor allem schnellere Ladezeiten ermöglichen. Wenn man denn eine Ladestation finden kann, die 100 kW abliefert. Denn die machen nur 20 Prozent aller Ladepunkte in Deutschland aus und sind zudem meist nur an den Autobahnen zu finden.
Es ist also wichtig, dass Kommunen beim Ausbau ihrer Ladeinfrastruktur sehr weit in die Zukunft denken. Das bedeutet auch, dass der Neuaufbau der Ladepunkte deutlich teurer werden wird. Aber auf lange Sicht ist es günstiger direkt auf Schnelllader zu setzen, sonst muss man ein paar Jahre später erneut investieren.
Don Dahlmann ist seit über 25 Jahren Journalist und seit über zehn Jahren in der Automobilbranche unterwegs. Jeden Montag lest Ihr hier seine Kolumne „Drehmoment“, die einen kritischen Blick auf die Mobility-Branche wirft.

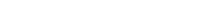 Yahoo Finanzen
Yahoo Finanzen 