Kampf gegen Ärztemangel und Pflegenot: So rettet die Zuwanderung unser Gesundheitssystem – laut neuen Zahlen

Wer in Deutschland in einem Krankenhaus arbeitet, behandelt werden muss, oder dort Angehörige oder Freunde besucht, stellt fest: Kliniken sind längst zu einem besonders internationalen Arbeitsort geworden. Zunehmend gilt das auch für Arztpraxen. Das belegen jetzt auch neue, offizielle Zahlen. Fast ein Viertel der Ärzte und Ärztinnen in Deutschland kommt aus dem Ausland.
In der Medizin sind die Folgen des demografischen Wandels geradezu beispielhaft zu beobachten. Viele Ärzte gehen bald in den Ruhestand. Um die Lücken zu füllen arbeiten in Deutschland immer mehr Mediziner aus anderen Ländern. Das Beispiel zeigt auch, dass Zuwanderung von Fachpersonal für Deutschland - im Sinne des Wortes - lebenswichtig ist.
Fast ein Drittel (31 Prozent) der Mediziner in Deutschland ist 55 Jahre und älter. Das gilt nicht nur für Hausärzte, Fachärzte oder Chirurgen, sondern auch für Zahnärzte. Der Anteil der Altersgruppe vor dem Ruhestand ist in der Medizin noch einmal höher als bei allen Erwerbstätigen (26 Prozent), errechnete das Statistische Bundesamt. In nur zehn Jahren ist der Anteil der älteren Mediziner in Deutschland von 26 auf 31 Prozent geklettert. Dagegen ist der Anteil im mittleren Alter gesunken. Droht ein Ärztemangel?
Krankenhäuser schließen die Lücken zunehmend mit Ärztinnen und Ärzten aus dem Ausland. Auch in Praxen niedergelassener Mediziner wächst ihr Anteil. Für das Pflege- und Hilfspersonal gilt das ohnehin schon lange. Insgesamt gab es in Deutschland 2023 rund 500.000 Ärztinnen und Ärzte. 62 000 von ihnen hatten keine deutsche Staatsangehörigkeit. Das sind zwölf Prozent oder etwa jeder achte. Vor zehn Jahren arbeiteten erst 29.000 ausländische Mediziner in Deutschland. Der Anteil wird steigen. Denn von den ausländischen Ärztinnen und Ärzten ist rund die Hälfte jünger als 35 Jahre.
Zuwanderung: 115 000 Ärzte für Deutschland
Dabei ist der Anteil der Ärzte, die aus dem Ausland gekommen sind, sogar noch höher. „In der Human- und Zahnmedizin arbeiteten 2023 insgesamt 115 000 aus dem Ausland zugewanderte Ärztinnen und Ärzte“, schreiben die Statistiker. Anders gesagt: Fast ein Viertel aller Mediziner in Deutschland ist aus dem Ausland hierher gekommen. Die Zahl ist deshalb höher als die 62.000 ausländische Ärzte, weil ein Teil der zugewanderten Mediziner inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt.
Die Akzeptanz technischer oder gesellschaftlicher Umbrüchen geht häufig von der Medizin aus. Hier ist der Nutzen für die Menschen oft unmittelbar erkennbar. Das zeigt sich bei der Zuwanderung auch bei der Anerkennung ausländischer Berufsabschüsse. Die fehlende Anerkennung verhindert immer noch oft, dass gut ausgebildete Menschen nach Deutschland kommen oder dass sie arbeiten dürfen, wenn sie bereits in Deutschland leben, zum Beispiel als Geflüchtete.
Medizin dominiert bei anerkannten Abschlüssen
Bei den Berufen, in denen ausländische Abschlüsse in Deutschland anerkannt werden, dominiert das Gesundheitswesen eindeutig. Zu groß ist der Mangel, zu klar der Nutzen. Ohne Pflegepersonal aus dem Ausland ginge in Deutschland schon lange nichts mehr. Der Beruf, bei die meisten Abschlüsse anerkannt werden, sind Gesundheits- und Krankenpfleger mit zuletzt 18.500 Anerkennungen im Jahr 2022. Auf Platz zwei folgen bereits Ärzte und Ärztinnen mit 8600 Anerkennungen.
Darunter waren auch die Abschlüsse von 1.300 Deutschen, die im Ausland Medizin studierten. Auf Rang zwei folgen mit 400 anerkannten Abschlüssen Ärzte und Ärztinnen aus Syrien. Viele von ihnen sind in Folge des Bürgerkrieges in Syrien in den vergangenen zehn Jahren nach Deutschland gekommen.
Zahnärzte lagen übrigens auf Rang fünf der Anerkennungen ausländischer Berufsabschlüsse. 2022 wurden in der Zahnmedizin gut 600 ausländische Abschlüsse als voll gleichwertig anerkannt. Auch folgen auf die Abschlüsse von Deutschen im Ausland Zahnmediziner aus Syrien.
Mehr junge Menschen beginnen ein Medizinstudium
Deutsche wählen ein Medizinstudium im Ausland zum Teil auch, um die Zulassungsbeschränkungen des Studienfachs zu umgehen. Allein in Österreich studierten 2.600 Deutsche Humanmedizin, in Ungarn waren es knapp 2 100 und in Polen 900. „Auch in der Zahnmedizin zog es die meisten deutschen Auslandsstudierenden nach Österreich (500) und Ungarn (200)“, so die Statistiker.
Die Zahl der jungen Menschen, die in Deutschland ein Studium der Humanmedizin beginnen, steigt. Im Wintersemester 2022/2023 waren es 4.300 Studierende. Das waren 17 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor. In der Zahnmedizin hat sich die Zahl dagegen kaum und liegt stabil knapp unter 1.900 pro Semester.
Auch in der Medizin sinken die Arbeitszeiten
Wie in der Wirtschaft allgemein, so tragen auch in der Medizin kürzere Arbeitszeiten zum Engpass an Arbeitskräften bei. Ein Grund ist der gestiegene Anteil der Teilzeitarbeit. „Dennoch zählen Ärztinnen und Ärzte nach wie vor zu den Erwerbstätigen mit überdurchschnittlich langen Arbeitszeiten“, stellen die Statistiker fest. 2023 arbeiten sie im Durchschnitt 40,7 Stunden pro Woche. Wer in Vollzeit arbeitete,kam sogar auf 46,2 Wochenstunden. Bei Teilzeit waren es 25,9 Stunden). Das sind rund sechs Stunden pro Woche mehr im Durchschnitt aller Berufe.
Auch innerhalb der Medizin unterscheiden sich die Arbeitszeiten je nach Fachrichtung erheblich. In der Chirurgie arbeiteten Fachärztinnen und Fachärzte in Vollzeit im Schnitt fast 50 Stunden pro Woche.

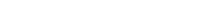 Yahoo Finanzen
Yahoo Finanzen 