Warum die Schweiz nicht als Vorbild für die Briten taugt
Gute Geschäfte mit der EU ohne zu große Verpflichtungen: Die Schweizer leben den Traum der Briten. Als Brexit-Blaupause reicht das allerdings nicht.

Zusammen ist man weniger allein: „It’s a match!“, spotteten die Macher der Schweizer Late-Night-Show „Deville“ nach dem Brexit-Referendum in einem Comedy-Clip. Die Comedians schlugen der Schweiz und Großbritannien die Gründung einer „Europäischen Union der Nicht-Europäische-Union-Mitglieder“ vor. Wie wäre es etwa mit einer engen Kooperation im Finanzsektor? „Eure Banken waschen das Geld, unsere Banken verstecken es“, so der unorthodoxe Vorschlag der Komiker.
Die schweizerisch-britische Gemeinschaft war natürlich nur als Spaß gemeint. Doch tatsächlich wird die Eidgenossenschaft in Großbritannien mitunter als Vorbild dafür gesehen, was die künftigen Beziehungen zur Europäischen Union nach dem Brexit ausmachen soll. Experten warnen aber davor, beide Fälle zu vergleichen – zu groß sind die Unterschiede.
Großbritannien wird die Europäische Union am Freitag verlassen. Bis Ende des Jahres gilt eine Übergangsphase, während der London und Brüssel ein Abkommen über die künftigen Beziehungen aushandeln wollen.
Die Schweiz hat vorgemacht, dass sich mit Geschick durchaus einige Vorteile in den Verhandlungen mit Brüssel erzielen lassen. Die Schweiz profitiert also von der engen Bindung an die Nachbarn, ohne Mitglied der EU zu sein. Jeden Arbeitstag tauschen Schweizer und Europäer Güter im Wert von rund einer Milliarde Franken aus. Nach den USA und China ist die Schweiz damit für EU-Staaten der größte Handelspartner.
Dem Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum erteilte im Jahr 1992 die knappe Mehrheit der Schweizer eine Absage. Seitdem setzen die Eidgenossen auf den sogenannten „bilateralen Weg“. Mehr als 100 Einzelabkommen, die „bilateralen Verträge“, regeln das Verhältnis zwischen Schweiz und EU. Die Spanne reicht von der Personenfreizügigkeit bis zur „Handelsregelung für Suppen, Soßen und Würzmittel“.
Taugt die Eidgenossenschaft damit als Vorbild für Großbritannien? Das scheinen zumindest manche Brexit-Befürworter zu hoffen. „Die Menschen in Norwegen und der Schweiz sind glücklich“, sagte etwa der Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage. „Ihre Länder haben einen Deal mit der EU und dieser sichert ihnen die Handelsbeziehungen, die sie wirklich wollen.“
Kernthema Personenfreizügigkeit
Und so pilgerten britische Abgeordnete nach dem Brexit-Referendum zum Ortsbesuch an die deutsch-schweizerische Grenze, als ließe sich dort die Lösung für die irische Grenzfrage finden. Und schweizerische Zollbeamte wurden sogar zu Gesprächen des Brexit-Untersuchungsausschusses des britischen Parlaments nach London geladen.
Doch Experten warnen davor, die Erfahrungen aus der Schweiz auf Großbritannien zu übertragen: „Die Schweiz taugt für die künftigen britisch-europäischen Beziehungen nicht als Blaupause“, sagt Klaus Armingeon, Professor am Lehrstuhl für Vergleichende Politik und Europapolitik der Universität Bern.
Denn ein zentraler Teil der bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU ist die Personenfreizügigkeit – also das Recht für EU-Bürger, in der Schweiz wohnen und arbeiten zu dürfen und umgekehrt. „Und das ist genau das, was die Briten nach dem Brexit auf keinen Fall haben wollen“, sagt Armingeon. „Mit Blick auf die Personenfreizügigkeit kann die Schweiz aus britischer Sicht also gar kein Vorbild sein“. Das Ende des freien Zuzugs von EU-Bürgern galt als eine der Hauptbegründungen für den Brexit. Die Personenfreizügigkeit stößt zwar auch in der Schweiz auf Kritik, gilt aber als fester Teil der gegenseitigen Beziehungen – zumindest bislang.
Die rechtsnationale SVP will die Personenfreizügigkeit im Mai mit einer Volksinitiative aufkündigen. Doch der „Kündigungsinitiative“ werden an der Urne kaum Chancen eingeräumt. Denn die Personenfreizügigkeit gilt in Brüssel als rote Linie. Ihre Abschaffung dürfte auch das Ende der anderen bilateralen Verträge bedeuten. Die Schweizer Regierung rät deshalb, die Initiative abzulehnen.
Dass sich die Menschen innerhalb der EU-Länder frei bewegen können, ist ein wesentliches Element der vier Grundpfeiler des europäischen Binnenmarkts: freier Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital. Versuche der Schweiz, die Zuwanderung zu begrenzen, werden deshalb in Brüssel äußerst skeptisch verfolgt.
Die Realität ist also deutlich komplizierter, als Brexit-Befürworter behaupten. In vielen Politikbereichen müssen die Schweizer die EU-Regeln umsetzen, ohne bei deren Entstehung mitreden zu dürfen – das passt so gar nicht zum Versprechen britischer Politiker, nach dem Brexit die Kontrolle zurückzuerlangen.
Die EU will einen Deal erzwingen
Andere Themen sind beim bilateralen Weg gänzlich ausgenommen. Darunter ein Punkt, der für Großbritannien und seinen Finanzsektor besonders wichtig ist: die Finanzdienstleistungen. Schweizer Maschinenbauer dürfen ihre Anlagen zwar nach Europa liefern, die Banken des Landes klagen beim grenzüberschreitenden Handel aber über Restriktionen. So bleibt nur der Weg über Einzelabkommen mit einzelnen EU-Staaten, etwa mit Deutschland.
Aber auch in Brüssel herrscht über das Verhältnis zur Schweiz regelmäßig Frust. Manches Zugeständnis, dass die Schweiz den Brüsselern abringen konnte, dürfte dort heutzutage von Diplomaten bereut werden. Die EU will die Beziehungen mit einem so genannten „Rahmenabkommen“ auf eine neue Grundlage stellen, doch die Schweiz zeigt sich von diesem Vorhaben wenig angetan. Das Abkommen regelt etwa die automatische Übernahme neuer EU-Standards und den Umgang mit Konflikten.
Der ehemalige Kommissionschef Jean-Claude Juncker hatte das Abkommen zur Chefsache erklärt: Mit einer Mischung aus Küsschen und Drohgebärden wollte er die Schweizer zur Annahme des „Freundschaftsvertrags“ bewegen – ohne Erfolg. Die Schweizer Regierung will das Abkommen nicht unterzeichnen.
Es gilt bei den Bürgern als nicht mehrheitsfähig, sowohl Gewerkschaften als auch die rechtskonservative SVP machen dagegen Front. Dass die EU der Schweizer Börse als Daumenschaube in den Verhandlungen den Marktzugang erschwerte, kam bei den Eidgenossen nicht sonderlich gut an. So hat die neue Kommissionschefin Ursula von der Leyen das leidige Thema von ihrem Vorgänger geerbt.
So könnte die Schweiz bei den Verhandlungen zwischen Brüssel und London durchaus als Beispiel dienen – dafür, wie man es lieber nicht macht. Politologe Armingeon glaubt, dass die Erfahrungen der Europäischen Union mit der Schweiz bei den Verhandlungen mit Großbritannien durchaus eine Rolle spielen werden. „Die Vertreter der EU dürften sich genau überlegen, ob sie noch einmal bilaterale Verträge mit einem Nachbarland eingehen, ohne die Beziehungen mit einem umfassenden Rahmenabkommen zu regeln.“
Mehr: Am Freitag tritt Großbritannien aus der EU aus. Die künftige Partnerschaft mit Großbritannien sollte auf gleichen Wettbewerbsbedingungen beruhen.
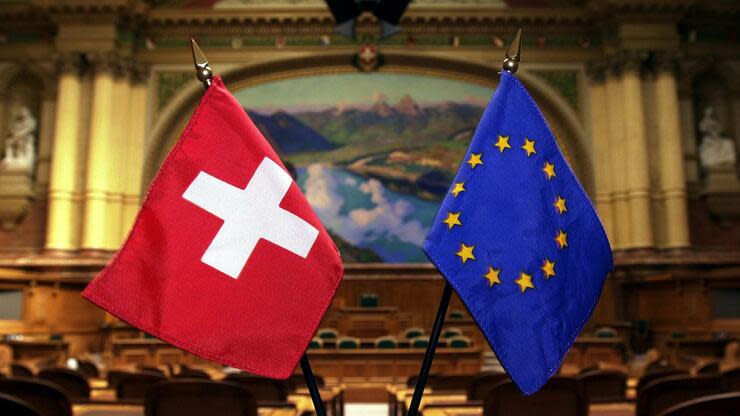

 Yahoo Finanzen
Yahoo Finanzen 