Warum das Hausarztmodell der AOK Baden-Württemberg so erfolgreich ist

Die gesamte Gesundheitsversorgung soll auf einem Qualitätswettbewerb zwischen den Krankenkassen basieren, so stellte sich die ehemalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) das Gesundheitssystem der Zukunft vor. 2007 brachte sie dazu ein Gesetz mit dem Namen „GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz“ auf den Weg. Doch von Wettbewerb ist heute keine Spur.
Im Gegenteil: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat den Krankenhäusern gerade detaillierte Vorgaben für die Personalausstattung im Pflegebereich gemacht. Sie sollen einheitlich gelten vom Bodensee bis Flensburg. Mit dem von Ulla Schmidt seinerzeit ausgerufenen Qualitätswettbewerb unter den Krankenkassen hat das nichts mehr zu tun.
Mit der AOK Baden-Württemberg hat immerhin eine Krankenkasse Schmidts Aufruf ernst genommen. Seit Oktober 2008 baute sie in Kooperation mit dem Hausarztverband und dem Ärzteverband Medi das dichteste hausarztzentrierte Versorgungssystem (HZV) in Deutschland auf. Seit einigen Jahren wird es auch durch Facharztverträge ergänzt.
Nachahmer hat das Projekt der AOK in der Form keine gefunden, dabei ist es in den Augen des Vorsitzenden des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung des Gesundheitswesens, Ferdinand Gerlach, ein Beleg, dass sich durch eine am Bedarf der Versicherten orientierten Steuerung die Gesundheitsversorgung der Menschen deutlich verbessern lässt.
„Dabei haben wir festgestellt, dass die Verbesserungen im Zeitablauf immer größer geworden sind“, sagte der Leiter des Instituts für Allgemeinmedizin der Universität Frankfurt. Es hat gemeinsam mit Experten der Universität Heidelberg die Bewertung über zehn Jahre durchgeführt. „Beeindruckend ist zum Beispiel die Entwicklung der Folge- und Begleiterkrankungen bei Diabetikern.“
Hier komme es deutlich später und in weit geringerem Umfang zu Komplikationen wie Dialyse, Erblindung, Amputationen, Herzinfarkten oder Schlaganfällen. Allein zwischen 2011 und 2016 hätten 4000 schwerwiegende Komplikationen vermieden werden können.
HZV-Patienten leben auch länger als Menschen, die sich nicht in den baden-württembergischen Hausarztvertrag eingeschrieben haben. Davon ist zumindest der ärztliche Direktor der Abteilung für Allgemeinmedizin an der Universität Heidelberg, Joachim Szecsenyi, überzeugt.
Es sei zwar noch nicht möglich, alle Einflussfaktoren zu kontrollieren. Dennoch zeige sich bei einer Betrachtung des Zeitraums zwischen 2012 bis 2016, dass das Risiko zu versterben geringer ist als in der Normalversorgung. „Wir können mit Fug und Recht von 1700 vermiedenen Todesfällen in diesem Zeitraum sprechen.“
Für das hochgelobte AOK-Projekt mit immerhin 1,6 Millionen eingeschriebenen Versicherten ist Christopher Hermann verantwortlich. Ein Terminservicestellengesetz, wie es jetzt Spahn auf den Weg gebracht habe, damit Patienten schneller einen Arzttermin bekommen, „brauchen wir in Baden-Württemberg nicht“, sagt er. „Wir haben längst den schnellen, unkomplizierten Arztzugang, die intensive Betreuung, bessere Vergütung und die klare Aufwertung der sprechenden Medizin am Netz.“
Das lässt sich die AOK auch etwas kosten. Für die bislang sechs strukturierten Facharztverträge entstanden 2016 Mehrausgaben von 8,4 Prozent. 26 Prozent teurer als in der Regelversorgung waren auch die erhöhten Vergütungen für die teilnehmenden Hausärzte.
Doch dagegen stehen Einsparungen bei dem weit teureren Kostenblock Krankenhausbehandlung um 5,3 Prozent. Einsparungen von 6,2 Prozent bringt der rationalere Einsatz von Medikamenten. Unter dem Strich, so Hermann, bedeute das Einsparungen gegenüber der Regelversorgung von 8,3 Prozent.
Wo diese Einsparungen herkommen, erläuterte Berthold Dietsche, Chef des Hausärzteverbands Baden-Württemberg. „Die hausarztzentrierte Versorgung gibt richtige Antworten auf Kernprobleme der ärztlichen Selbstverwaltung“. Dazu zähle eine leistungsgerechte Honorierung, ohne die in der Regelversorgung geltenden Obergrenzen, einfache Abrechnungsregeln und ein verbindliches Einschreibsystem.
Dieses sei die Voraussetzung für eine wirksame Steuerung der Versorgung. In der Regelversorgung würden viele Versicherte zwei und drei Mal nur deshalb einbestellt, damit der Arzt mehr abrechnen kann. In der HZV gebe es eine hohe Pauschale. Da habe der Arzt solche reinen Bestelltermine nicht nötig, erläuterte Dietsche.
Ein Ergebnis ist, dass es in der HZV im Jahr 2,1 Millionen mehr Hausarztkontakte und 1,2 Millionen weniger unkoordinierte Facharztbesuche gibt. Zum Facharzt geht nur, wer dort auch Hilfe erwarten kann. Dafür sorgt der Hausarzt mit seiner Lotsenfunktion. Vor allem das Arzt-Hopping fällt weg.
„Wir haben in Deutschland inzwischen 20 Arzt-Kontakte pro Patient und Jahr“ sagt Ferdinand Gerlach, Chef der Gesundheitsweisen. Das sei weltweit ein Spitzenwert, aber leider kein Ausweis einer gut funktionierenden Gesundheitsversorgung. Die setze in der Tat eine strukturierte Steuerung der Versorgung voraus. Das bedeute am Ende schnellere und bessere Hilfe bei weniger Arztbesuchen. Die würde sich Gerlach auch außerhalb der 1,6 Millionen an der HZV der AOK Baden-Württemberg teilnehmenden Patienten wünschen.
Ähnlich äußerte sich auch Hermann. Er kündigte an, er wolle sich von der aktuellen zentralistischen und allein auf das Kollektivvertragssystem ausgerichteten Gesundheitspolitik nicht beirren lassen. „Wir hätten im vergangenen Jahr im System der Regelversorgung glatte 50 Millionen Euro mehr ausgegeben – bei schlechterer Versorgung der Versicherten.“
Er werde daher die 2008 begründete „alternative Regelversorgung“ 2019 um weitere Facharztgebiete erweitern „mit Nephrologie, Pulmologie und HNO.“ Auch der Krankenhausbereich soll in die HZV stärker integriert werden. Ganz oben auf der Liste stehen Knie- und Hüft-OPs. Hier wird in der Regelversorgung besonders oft voreilig zum Skalpell gegriffen und an manchen Kliniken ist die Komplikationsrate sehr hoch. Das Ergebnis: schlechtere Versorgung zu hohen Kosten.

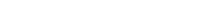 Yahoo Finanzen
Yahoo Finanzen 