Besser als ChatGPT: Auf diese fünf Startups wettet KI-Investor Adrian Locher

Wenn man Adrian Locher zu KI befragt, spricht er erst einmal eine Warnung aus. „Um ganz ehrlich zu sein: Das meiste, was wir als ‚KI-Startups‘ gerade sehen, wird aus meiner Sicht nicht funktionieren“, sagt der Schweizer. Das mache eben dieser Hype um das Thema. Wenn Gründer sagen, sie würden etwas mit KI machen, bekämen sie erstmal die Aufmerksamkeit der Investoren. Deshalb machten das gerade eben auch alle. Aber: „Diese Startups werden in zwei Jahren alle wieder verschwunden sein.“
KI ist die neue Dampfmaschine
Dennoch glaubt Locher natürlich an KI, sehr sogar. Er meint sogar, dass Künstliche Intelligenz die Menschheit mindestens so stark beeinflussen wird wie die Erfindung der Dampfmaschine. Und er hat einen erheblichen Teil seines eigenen Vermögens auf das Thema gesetzt: Seit 15 Jahren ist er Serien-Gründer und Angel-Investor.
Mit DeinDeal hat er einst ein führende E-Commerce-Unternehmen der Schweiz aufgebaut und 2015 bei 100 Millionen Euro Umsatz verkauft. Dann ging er für eine Weile nach San Diego, 2016 startete er mit Rasmus Rothe Merantix, ein „Venture Studio“, wie es heißt. Eine Art Inkubator und Hub für KI-Startups, die alle auf Lochers AI Campus in Berlin zusammenkommen.

Locher kann genau erklären, wann KI-Startups eine Chance haben und wann nicht: „Das Problem ist, dass die meisten sich irgendwo auf eher oberflächlichen Levels bewegen und sagen: Wir machen jetzt hier ein bisschen generative KI.“ Man müsse unterscheiden, erklärt der KI-Experte: Auf der einen Seite sei der „Application Layer“, also die Anwendung, das Tool, das eben mit KI arbeitet, um irgendein Problem zu lösen. Dem gegenüber stünde das „Infrastructure Layer“, so Locher, also die KI selbst, innerhalb der Anwendung.
Trends in der Entwicklung von KI: Wer KI-Infrastruktur baut, hat wenig Chancen
Infrastruktur ist in Lochers Augen eher langweilig. „Die ganzen LLM-Unternehmen, die ‚large language models‘ machen, also Open AI beispielsweise, die sind aus unserer Sicht Infrastruktur-Unternehmen. Vergleichbar mit den heutigen Cloud-Anbietern, die praktisch Computing aus der Steckdose anbieten.“ Von denen würden sich nur die allerwenigsten durchsetzen, weil sie im Grunde alle dasselbe anbieten, ein mehr oder weniger homogenes Gut: KI aus der Steckdose, sozusagen.
Anwendungen mit KI hingegen sind interessant und relevant, sagt Locher. Startups, die sich mit der Anwendungsebene beschäftigen, also dort, wo KI Kunden direkt erreicht, hätten ein viel größeres Differenzierungspotenzial. Entsprechend sei die Wertschöpfungsmöglichkeit größer. „Hier ist mehr Geld“, drückt Locher es ganz direkt aus und erklärt den sogenannten „Fly-Wheel-Effekt“, der eintritt, wenn eine dazu lernende KI immer besser wird je besser sie wird.

Fantasie ist gefragt – und multidisziplinäre Teams
Das Problem mit den Anwednungsfällen von KI: auf die muss man erstmal kommen. Das sind genau die Sachen, wofür es die oft beschworenen „Visionäre“ braucht, die sich wirklich etwas ausdenken können, was es noch nicht gibt. „Im Grunde musst du halt in die Bereiche schauen, die heute noch von Menschen bearbeitet werden, wo es aber Sinn macht, in der Zukunft die Arbeit durch die Maschine machen zu lassen. Medizin ist ein schönes Beispiel“, sagt Locher, um dann aus seinem eigenen Portfolio zu erzählen.
Vara etwa ist ein Startup, das sich mit der Früherkennung von Brustkrebs bei Patentinnen in insbesondere ärmeren Ländern beschäftigt. Klingt im ersten Moment nicht nach einer Firma, die auf dem Berliner AI Campus richtig angesiedelt wäre. Ist sie aber: Die Gründer haben nämlich eine KI mit zehn Millionen Patientinnendatensätzen geschult, die Bilder von Mammographien auf Krebsanzeichen durchzuschauen. Sie kann das mittlerweile so gut wie Fachärzte, die diese Bilder sonst anschauen. Aber sie ist schneller und günstiger und für Patientinnen etwa in Nordafrika oder Lateinamerika erreichbarer.
Locher hat hier in einen Brustkrebs-Screening-Anbieter investiert, eher als in in KI-Startup. Er spricht von einer „vertikal voll integrierten Wertschöfpungskette“. „End-to-end, wie man das so schön nennt“, sagt er. „KI ist dann angekommen, wenn eigentlich niemand mehr von der KI redet, sondern von den Anwendungen, die sie ermöglicht“, fasst Locher zusammen.
Für die Gründung solcher anwedungsbezogenen KI-Startups bedarf es diverser Teams. Leute aus unterschiedlichen Fachbereichen, die zusammenarbeiten. Etwa aus IT oder KI und Medizin. Oder Biologie. Oder Chemie. An den Universitäten in Europa sei der „liberal art Gedanke“ nicht weit genug ausgeprägt, sagt Locher, was dazu führe, dass Leute oft in Silos denken, das Vernetzen über wissenschaftliche Disziplinen hinweg passiere zu selten. Ein Wettbewerbsnachteil in der KI-Branche, findet Locher.

KI in Deutschland im internationalen Vergleich
In der KI-Forschung sei Deutschland im internationalen Vergleich exzellent, so der Experte. In Sachen KI-Anwendung hingegen sei man hier sehr langsam. „Einer der Gründe ist natürlich schon die Finanzierung“, sagt Locher. „Um aus Grundlagenforschung erfolgreiche Umsetzungen zu machen, braucht es viel Mut. Privates Geld reicht da meistens nicht.“ Öffentliche Gelder würden hierzulande aber selten in echte Moonshot-Projekte gesteckt. Und dass es hierzulande skeptisch beäugt wird, wenn etwa Wissenschaftler und Professorinnen sich an Startups aus ihrem Forschungsumfeld beteiligen, sei geradezu fatal.
Welche Voraussetzungen müssen KI-Startups in seinen Augen erfüllen?
Welche KI-Startups sind es nun aber konkret, die den Merantix-Gründer überzeugen? Um das sogenannte „Science Risk“ möglichst gering zu halten, müssten Startups, die vor ihm pitchen, nachweisen, dass ihre Innovationen im Labor stabil funktionieren. Grundlagenforschung unterstütze er mit Merantix nicht direkt. Und natürlich: „Wenn wir uns Cases anschauen, dann ist für uns die Technologie wirklich nur ein Mittel zum Zweck“, wiederholt er und betont damit seinen Fokus auf die Anwendungsebene. Wenn der Service eine KI nur sei, ein Bild zu generieren, Bewerbungsschreiben oder Hausaufgaben zu machen, interessiere ihn das nicht. Entscheidend seien folgende Fragen:
Wertschöpfung:
Welche Form von Businessmodell kannst du damit kreieren?
Welche Form von Value Creation kannst du damit schaffen?
Und ganz wichtig: Wie gelingt es dir, möglichst viel von diesem Value, der vorne generiert wird, auch zu behalten?
Daten:
Wem gehören die von der KI verwendeten Daten?
Was kann ich mit den Daten machen?
Habe ich die Chance, die Daten so besitzen oder zumindest nutzen zu dürfen? („Nur so kann man langfristig diesen Fly-Wheel-Effekte kreieren und auch besser bleiben als die Konkurrenz“, erklärt Locher.)
Mit seinen Investments bewege Merantix sich stets in stets in Bereichen mit "hoher gesellschaftliche Relevanz, in denen drängende Probleme mit neuen Ansätzen gelöst werden", wie Locher sagt: Medizin, Biotech, Energie und Klima, aber auch Mental Health und Fertilität. „Grundvoraussetzung ist, dass wir uns vorstellen können, wie diese Unternehmen in seinem Bereich auch wirklich als führender Anbieter bestehen kann.“

Adrian Lochers fünf Rising Stars

Taktile
Das Berliner Startup Taktile hat eine Software für Versicherungsunternehmen und Banken entwickelt, um denen mittels Künstliche Intelligenz bei Entscheidungsprozessen zu helfen. Das sei etwa, wofür sonst viele teure Experten bedürfe, sagt Locher. Die Gründer Maik Taro Wehmeyer und Maximilian Eber gründeten ihre Firma 2020 im Rahmen des Y-Combinator Accelerator-Programms aus und konnten seitdem namhafte Investoren gewinnen wie Index Ventures und den Silicon-Valley-VC Tiger Global. In der Series-A sind 20 Millionen Euro geflossen.
Helsing
Dual-Use-KI: Das Münchener Startup Helsing entwickelt Verteidigungssoftware. KI erkennt wiederkehrende Muster hinter Daten aus Kameras, Wärmebildern, Radardaten und anderen Sensoren und kann so beispielsweise feindliche Truppenbewegungen voraussagen. Spotify-Gründer Daniel Ek investierte als einzelner Investor 100 Millionen Euro in die Militär-KI.
Auch Adrian Locher sieht hier "auf jeden Fall Riesenpotenzial", wie er sagt. "Defense ist ein Thema. Das ist einfach wichtig für uns als Gesellschaft, weil Sicherheit nicht gottgegeben ist." Die Software von Helsing könnte Verteidigungssysteme verbessern, indem ihre KI Soldaten bei der Einschätzung von Gefechtslagen hilft und militärische Ziele sorgfältiger auswählt – ohne Zivilisten in Gefahr zu bringen. Helsing wird in Investorenkreisen schon länger als Unicorn-Anwärter gehandelt und hat im September 2022 eine Kooperation mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall geschlossen, um gemeinsam ein softwarebasiertes Waffensystem zu entwickeln.

Brighter.ai
Brighter AI entwickelt eine Künstliche Intelligenz, die Objekte in Bildern und Videos anonymisiert. So werden etwa Gesichter verzerrt oder Nummernschilder von Autos unkenntlich gemacht. Der Nutzen liegt darin, dass dieses angepasste Videomaterial dann für weitere Analysen, zum Beispiel für autonomes Fahren, genutzt werden kann – ohne Probleme beim Datenschutz zu bekommen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2017 von Marian Gläser und Patrick Kern. Die Berliner Firma ist ein Spin-off des Autozulieferers Hella. Bei einer Series-A Runde 2022 beteiligte sich führend der portugiesischen VC Armilar Venture Partners, im Februar 2023 zog der Investment-Arm DB Digital Ventures nach und investierte einen Betrag in nicht genannter Höhe.

German Bionic
Das Startup, das 2016 von Armin G. Schmidt, Michael Halbherr und Peter Heiligensetzer gegründet wurde, hat seine Hauptsitze in Deutschland und in den USA, mit Büros in Berlin, Boston, Augsburg und Tokio. Es entwickelt und baut sogenannte Exoskelette, Anzüge quasi, die vor allem zum Heben und Bewegen von schweren Gegenständen in der Industrie, im Handwerk oder bei Logistik-Unternehmen gedacht sind. Oder bei der Gepäcksortierung auf Flughäfen eingesetzt werden, indem Menschen sie überstülpen und in ihren Bewegungen von einer Art Roboter unterstützt werden. Das neueste Produkt der Firma ist ein Exoskelett für Pflegefachkräfte, das ihnen beim Heben und Stützen ihrer Patienten hilft. "Ich finde das total logisch: Bevor ich eine Maschine baue, die alles kann, mache ich lieber den Cyborg, wo der Mensch praktisch augmented und verbessert wird."
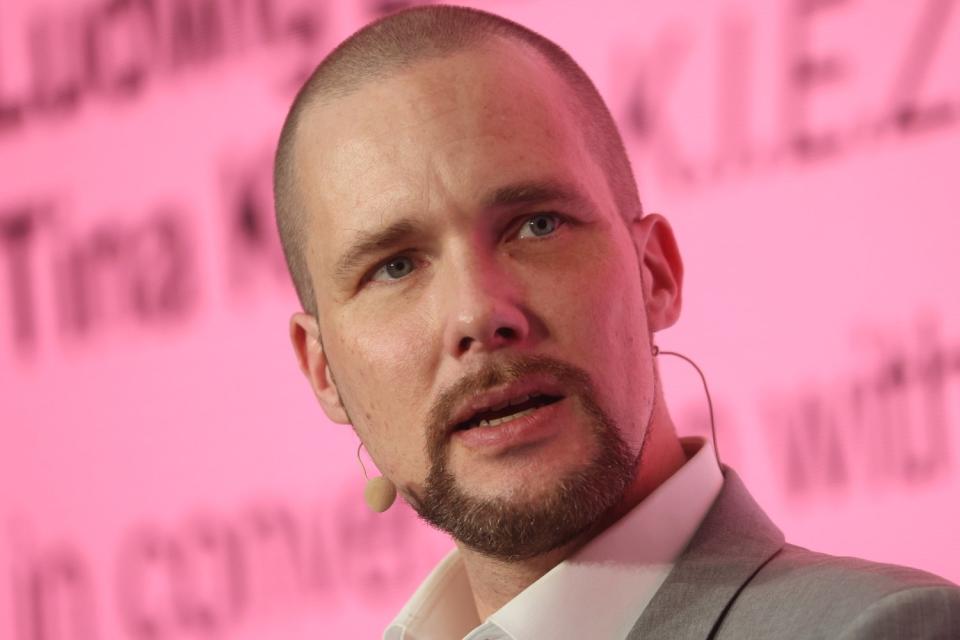
Aleph Alpha
"For obvious reasons" ist alles, was Adrian Locher dazu sagt, warum auch dieser Name auf der Liste seiner Rising Stars nicht fehlt: Das Heidelberger AI-Startup gilt gemeinhin als Deutschlands KI-Superstar. Aleph Alphas Modell gilt unter KI-Experten als die deutsche Antwort auf ChatGPT. Die Künstliche Intelligenz aus Heidelberg kann mit der weltberühmten KI von OpenAI mithalten, wie Tests gezeigt haben. In einem standardisierten Leistungsvergleich ließen die Macher von Aleph Alpha ihr Modell Luminous gegen das OpenAI-Sprachmodell GPT, die Version von Meta sowie gegen das offene Sprachmodell Bloom antreten. Unlängst kündigten Aleph Alpha und der IT-Dienstleister Hewlett Packard Enterprise (HPE) einen virtuellen Assistenten mit Künstlicher Intelligenz für die Industrieproduktion an.
Angst vor KI
Im vergangenen halben Jahr, seit ChatGPT das Thema KI in das breite Bewusstsein gebracht hat, wurde viel über mögliche Gefahren diskutiert, die von Künstlicher Intellogenz ausgehen können. Schlimmeres, als dass sie den Menschen ihre Jobs wegnehmen könnte. Mehr in die Richtung: Was, wenn da etwas entsteht, das größer ist als der Mensch, schlauer, nicht mehr zu beherrschen?
Immerhin: Hunderte Unternehmer, darunter Starhistoriker Yuval Noah Harari, Apple-Gründer Steve Wozniak, Turing-Preisträger Yoshua Bengio, Tesla-Chef Elon Musk haben sich gemeinsam hinreißen lassen, einen offen Brief über solche Gefahren und Sorgen zu schreiben, ein Moratorium für die KI-Forschung fordernd.
Adrian Locher nimmt diese Gedanken ernst – bleibt aber entspannt. „Der allergrößte Teil der Angst, die zurzeit diskutiert wird, ist für mich unbegründet“, sagt er. Natürlich müsse man darüber sprechen, auch Diskussionen über Maßnahmen zur Regulierung von KI seien richtig. „Wenn die Mehrheit der Menschen sich vor etwas fürchtet, dann bist du ja als Gesetzgeber verpflichtet, zu handeln. Ein Grundstein des Problem liegt dabei darin, dass die meisten Menschen KI schlicht nicht verstehen können, weil sie Software nicht verstehen.“ Deshalb reagierten sie verängstigt.
„Das klingt jetzt bisschen blöd, aber: Alles, was im Bereich KI derzeit passiert, ist immer noch sehr banal“, sagt der KI-Versteher. „Wir sind ganz, ganz weit davon weg, dass KI zwei Dinge kann, die Voraussetzung wären, dass es aus meiner Sicht gefährlich würde: Das eine ist ein eigenes Bewusstsein und das andere ist das Entwickeln eigener Ziele.“
Noch erfülle die Technik nur Aufträge, die man ihr vorgibt. Sie will nichts Neues aus sich heraus erreichen. „Wenn ich als Entwicklerin oder Entwickler merke, das führt an den falschen Ort, dann kann ich immer noch die Ziele ändern oder im schlimmsten Fall den Stecker ziehen. Dann geht nichts mehr.“ Aber das sei wie gesagt bloße Theorie. In der Praxis geht in Sachen KI derzeit richtig, richtig viel.

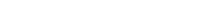 Yahoo Finanzen
Yahoo Finanzen 