Gemeinsam stark? Durch Gruppendenken zu falschen Entschlüssen

In der Gruppe getroffene Beschlüsse gelten als besonders effizient. Sie vermitteln den Anschein eines demokratischen Prozesses, der für Fairness und Sicherheit sorgt. Forscher warnen jedoch vor Gruppendenken.
Gemeinsam mit anderen entscheiden heißt richtig entscheiden, oder? Schließlich werden beim Entscheidungsprozess innerhalb der Gruppe mehrere Meinungen eingeholt. Daraus kann sich ja nur der richtige Entschluss ergeben, nicht wahr? Falsch.
Gruppendenken (Groupthink) ist ein seit Längerem bekanntes Problem bei Entscheidungsprozessen innerhalb von Unternehmen und Instituten. Wer sich also manchmal fragt, warum die Chefetage mit Vorschlägen aufwartet, die für jeden Außenstehenden ganz klar als Fehler erkennbar sind, dem könnte das Phänomen des Gruppendenkens eine Antwort liefern.
Wissenschaftler haben mehrere „Symptome“ für die Problematik identifiziert. Beispielsweise fallen Individuen, die sich in einer Gruppe oder einem Team zusammenschließen, der Illusion anheim, unfehlbar zu sein. Aufgrund der herrschenden Gruppendynamik gehen die Mitglieder davon aus, dass sie keine falschen Entscheidungen treffen können. Deshalb gehen sie häufig auch größere Risiken ein.
Lesen Sie auch: Aldi hält Lidl in Deutschland auf Distanz
Desweiteren handeln Gruppen oft „kollektiv rational“. Andere Meinungen oder Ansichten können dabei ausgeblendet werden. Auch Warnhinweise können ignoriert werden. Ein wichtiger Faktor, den Forscher entdeckt haben: Das „Wir-Gefühl“ kann bei Gruppen dazu führen, dass die Mitglieder stereotypische Sichtweisen über Nichtmitglieder besonders stark ausprägen. Fehlentscheidungen sind beinahe unvermeidbar.
Das hat auch die britische Zentralbank, die Bank of England, erkannt. Mehrere Studien hatten vor einem Jahr darauf hingewiesen, dass Gruppendenken innerhalb des geldpolitischen Rats vor der Finanzkrise 2008/2009 zu einem Nichterkennen möglicher Risiken an den Finanzmärkten geführt habe. Der gleichen Auffassung war damals auch der ehemalige britische Notenbanker Sir John Gieve.
Die Zentralbank hat reagiert: Sie hat das Rotationssystem für die Ratsmitglieder optimiert. Seit dem 1. Juli 2013 ist mit dem Kanadier Mark Carney erstmals in der Geschichte des 1694 gegründeten Instituts ein Nichtbrite Präsident der Bank of England.
Sehen Sie auch: Vermeiden Sie diese 5 Klicks

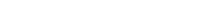 Yahoo Finanzen
Yahoo Finanzen 
