Gesetzliche Rente: Trugschluss der nachhaltigen Eigenvorsorge

Wenn ein Finanzberater einem Klienten empfiehlt, die bestehenden Möglichkeiten auszunutzen, freiwillige Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung zu zahlen, ist das verständlich. Denn man kann der Behauptung von SPD-Chefin Andrea Nahles nicht widersprechen, dass die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung eine Rendite von zwei bis drei Prozent abwerfen, die damit über der Rendite von neu abgeschlossenen privaten oder betrieblichen Rentenverträgen liegt.
Wenn aber Rentenexperten wie der rentenpolitische Sprecher der Grünen Markus Kurth die „dringende Empfehlung“ abgeben, die Möglichkeiten von freiwillige Beitragszahlungen deutlich auszuweiten und nicht erst ab dem 50. Lebensjahr zuzulassen, so zeugt das von einem Missverständnis der Funktionslogik dieses Umlagesystems.
Gleiches gilt für die Forderung der Linkspartei, die bislang angesparten Riester-Altersvorsorgevermögen in die gesetzliche Rentenversicherung zu übertragen.
Für umlagefinanzierte Sozialversicherungen ist es charakteristisch, dass die Beiträge des laufenden Jahres unmittelbar der Finanzierung der Leistungen dieses Jahres dienen.
Ursächlich stehen die in einem Jahr mit den Beiträgen erworbenen Ansprüche in keinem Zusammenhang mit den in diesem Jahr zu bedienenden Ansprüchen. Daher ist es möglich, bei der Etablierung einer umlagefinanzierten Sozialversicherung „Einführungsgeschenke“ zu verteilen, also Leistungen zu gewähren oder auszuweiten, für die die Empfänger in der Vergangenheit keine Beiträge in dieses System gezahlt haben.
Beispiele aus der Vergangenheit sind die Anhebung der Renten um bis zu 70 Prozent, als 1957 das derzeitige Umlagesystem eingeführt wurde oder die Leistungen an Pflegebedürftige, als 1995 die umlagefinanzierte soziale Pflegeversicherung etabliert wurde. Ein Geschenk – und zwar für die derzeitigen Rentner und rentennahen Jahrgänge – wäre es auch, wenn heute eine Summe an zusätzlichen Beiträgen gezahlt würde, und dies zu einer Senkung des Beitragssatzes und höheren Rentenanpassungen führen würde.
Eine rein umlagefinanzierte Sozialversicherung ist immer dann im finanziellen Gleichgewicht, wenn die Beitragseinnahmen den Ausgabeverpflichtungen des gleichen Jahres entsprechen.
Aus diesem Grund müssen Umlagesysteme zwingend obligatorisch sein, um einer Flucht von Beitragszahlern vorzubeugen. Freiwillige Beiträge auf der Grundlage eines temporären Renditevorsprungs stellen dagegen in Umlagesystemen eine destabilisierende Systemwidrigkeit dar. Denn als Finanzierungsbeitrag sind sie nicht verlässlich.
Die Rendite jeder Rentenversicherung wird durch den Zinssatz bestimmt, bei dem der Barwert der Einzahlungen des durchschnittlichen Mitglieds der Versichertengemeinschaft dem der Auszahlungen an dieses Mitglied entspricht.
Die Rendite eines neu abgeschlossenen kapitalgedeckten Rentenvertrags entspricht letztlich der derzeit an den Kapitalmärkten erzielbaren Rendite. Die Rendite der nach dem Umlageverfahren finanzierten gesetzlichen Rentenversicherung wird dagegen vom Wachstum der beitragspflichtigen Lohnsumme bestimmt, sieht man einmal von den systemwidrigen Steuerzuschüssen ab, die nicht der Finanzierung der versicherungsfremden Leistungen dienen. Dazu zählt etwa der 1999 zur Senkung des Beitrags dienende Ökosteuerzuschuss.
Nun sind einerseits die Renditen, die sich seit einiger Zeit mit sicheren Anlagen an den Kapitalmärkten erzielen lassen, ausgesprochen mager. Andererseits steigt die Lohnsumme nicht nur wegen der ordentlichen Lohnabschlüsse, sondern vor allem wegen der rasanten Beschäftigungsausweitung seit Jahren recht kräftig.
Doch der daraus erwachsende aktuelle Renditevorsprung der gesetzlichen Rentenversicherung ist flüchtig. Denn zum einen wird es selbst bei einer höheren Zuwanderung in den Jahren 2025 bis 2045 zu einem massiven Anstieg des Altenquotienten kommen. Die in den Arbeitsmarkt eintretenden Kohorten der Beitragszahler werden deutlich kleiner sein als die der in den Ruhestand wechselnden Jahrgänge. Zum anderen wird die derzeitige Niedrigzinsphase in den nächsten Jahren auslaufen.
Wer vor dem Hintergrund dieser absehbaren Entwicklung dazu aufruft, die Möglichkeit zu freiwilligen Beiträgen in die gesetzliche Rentenversicherung auszuweiten, der verschiebt – bewusst oder unbewusst - die Koordinaten dieser gegenwärtig solide aufgestellten obligatorischen Sozialversicherung ein Stück weit in die Richtung eines Schneeballsystems.
Die bisherigen Bemühungen, die Nachhaltigkeit unseres staatlichen Alterssicherungssystems auch in den kommenden Jahrzehnten zu gewährleisten, würden konterkariert. Denn was individuell rational sein kann, kann sich für das Kollektiv durchaus als fatal erweisen.
So würde ein Verzicht auf freiwillige Rentenbeiträgen nach einer Zinsnormalisierung die gesetzliche Rentenversicherung gerade dann verstärkt unter Druck setzen, wenn die demografische Entwicklung deren Finanzierung ohnehin schwieriger macht und ihre interne Rendite drückt.
Die nach dem italo-amerikanischen Betrüger Charles Ponzi (1882 bis 1949) benannten Ponzi-Spiele sind Kettenbrief- oder Schnellballsysteme, die dadurch charakterisiert sind, dass die Erfüllung der bei einer Einzahlung versprochenen Leistungen davon abhängt, dass sich zum Zeitpunkt der Fälligkeit genügend neue freiwillig einzahlende Spielteilnehmer finden, um die den früheren Einzahlern versprochenen Ansprüche bedienen zu können. Zu Recht sind solche Spiele verboten und deren Veranstalter werden gerichtlich belangt.
Wer für eine deutliche Ausweitung der Möglichkeit freiwilliger Beiträge plädiert, der verdrängt, dass aus diesen zusammen mit den obligatorischen Beiträgen die Leistungen der laufenden Periode finanziert werden und es keine Gewähr dafür gibt, dass es in der Zukunft stets genügend freiwillige Beitragszahler gibt. Und deswegen steht letztlich Charles Ponzis Geist hinter Vorschlägen, die Möglichkeiten der freiwilligen Beitragszahlung deutlich auszuweiten.

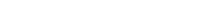 Yahoo Finanzen
Yahoo Finanzen 